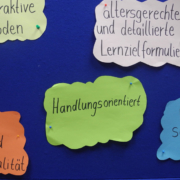Im Gespräch mit Hobskur
Cornelia Wilß von der Faust-Kultur sprach mit Hobskur über Hip Hop als Jugendkultur, Musik als politische Emanzipation, Repression und Aufbruch in Kamerun, Neokolonialismus und afrikanische Selbstbestimmung.
»Hör auf zu schießen!«
„Les mêmes” kam damals sehr gut an, das Lied wurde direkt für die kamerunischen Hip Hop Awards nominiert; bei jedem meiner Konzerte sang mir das Publikum den Refrain entgegen („c’est nous les voyous mais qui les voleurs”? – Wir sind die Herumtreiber, aber wer sind die Diebe?). Daraufhin wurde ich zu vielen Konzerten und Veranstaltungen wie der dreißigjährigen Jubiläumsfeier der wichtigsten kamerunischen regierungskritischen Tageszeitung „Le Messager” eingeladen.
Für das Album „menace sur ma planète»”, das 2010 erschien und auf Deutsch in etwa „Bedrohung auf meinem Planeten” bedeutet, wurde ich zwar nicht ausgezeichnet. Aber da es in der Kategorie bestes Rap-Album des Jahres bei den Hip Hop Awards nominiert war, kamen neue Angebote. Seitdem wissen alle Leute, denen ich auf der Straße oder auf den Märkten begegne, aber auch meine Familienangehörigen, dass ich Rap nicht nur mache, um Spaß zu haben. Ich begreife mich als Künstler, der sich sozial und politisch engagiert und deutlich eine Meinung vertritt.
Aber auch wenn meine Themen zum allergrößten Teil gesellschaftskritisch sind, ist auf „Menace sur ma planète” ein Lied wie „je veux” (Ich will) zu finden, das in Zusammenarbeit mit den Rappern 20 Cent und Nowell entstanden ist. Dieses Lied ist eher eine Kritik an der Konsumkultur.Welche Rolle spielt Hip Hop aktuell in Kamerun? Ist Rap ein Teil der kamerunischen Jugendkultur geworden? Wird die gesellschaftspolitische Kritik verstanden?Ob in den Vereinigten Staaten, in Frankreich, im Senegal oder in Kamerun. Hip Hop war schon immer eine Jugendbewegung, gemacht von Jugendlichen für Jugendliche. Hip Hop ist eine Lebensweise, ein Mittel des Ausdrucks, der von einem bestimmten Dresscode begleitet wird. Über diese Festlegung hinaus ist es jedoch schwer, Hip Hop eine bestimmte Rolle zuzuordnen, insbesondere in Kamerun. Es ist vielmehr eine mutierende Bewegung, die wächst, vieles umfasst und sich auch gegenüber anderen Kulturen öffnet. Man kann sicher sagen, dass Hip Hop in meinem Land seit über zwölf Jahren einen wichtigen Platz in der Künstler- und Musikerszene einnimmt. Seit einiger Zeit finden auch regelmäßig Hip Hop-Festivals statt.
Manche Künstler und Künstlerinnen wollen mit ihren Liedern einfach die Massen zum Tanzen bringen. Andere drücken ihre Gefühle von Liebe oder von Trauer aus. Für mich ist Hip Hop ein Kommunikationsmittel. Ich nutze den urbanen Stil, um einen kritischen Blick auf soziale und politische Themen zu entwickeln und zu präsentieren, die nicht rund laufen. Hip Hop kann eine Unterstützung sein, Menschen aus anderen Städten und Ländern schneller zu erreichen und eine kritische denkende Masse zu formen, je nach der Zielsetzung des Künstlers und seines Werkes.
Heutzutage ist Hip Hop ein Teil des Lebens von fast achtzig Prozent der jungen Kameruner und Kamerunerinnen. Hoffentlich übertreibe ich jetzt nicht; es gibt ja keine Statistik darüber. Doch mit der neuen Strömung des Afrobeats, der sich überall durchsetzt, ist es offensichtlich, dass mittlerweile alle mitmachen. Oder wie man bei uns in Kamerun sagen würde: „Même les paters et les maters sont dedans“ (Selbst die Väter und die Mütter gehören dazu).
Hobskur, Ihre Texte sind lyrisch/philosophisch und zugleich politisch. Wie gelingt es, einen Bogen zwischen Form und Absicht zu schlagen? Kann man die Wirkung im Sinne einer gesellschaftlichen Bewusstseinswerdung messen?
Jeder Künstler, der ein Album macht, will so viele wie mögliche Zuhörer finden. Niemand kann sich sicher sein, ob ein Lied erfolgreich sein wird, bevor es in die Öffentlichkeit kommt. Ob ein Lied beliebt ist oder nicht, hängt ganz allgemein davon ab, was und wie viel das Publikum versteht. Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, welche Auswirkungen meine Lieder auf mein Publikum haben. Bewusstseinsbildung lässt sich doch nicht an der Zahl der Menschen messen, die bei einem Konzert zusammenkommen. Ich messe die Wirkung eher an der radikalen oder progressiven Veränderung, die in jenen entsteht, die durch ein Lied angeregt werden, ihre Wahrnehmung zu schärfen.
Hip Hop nimmt keine präzise Rolle dabei ein. Nein, es ist eher eine präzise Intention, in jedem Kameruner, in jeder Kamerunerin dieses Fragzeichen hervorzurufen, das aus einem objektiven Blickwinkel gesehen zur Emanzipation Kameruns führen kann.
Damals als es mit der Rap-Musik begann, sagte man, Rapper seien „Poeten der Straße”, und Poesie erfordert nun einmal eine gewisse formale Struktur. Auch wenn ich die Form ab und an missachte oder darüber hinweggehe, aber dann immer aus Sorge um das, was ich vermitteln will.
Die philosophische Seite des Rap verleiht ihm Bedeutung und dekonstruiert das etablierte Vorurteil, das besagt, Rap sei die Kunstform derjenigen, die im Leben versagt haben. Es ist sehr schade, dass die Betonung dieses Aspekts oft eine Grenzlinie zwischen uns zieht. Und dass einige Fans, die nicht über eine Rap- und Rhythmuskultur oder eine soziale und politische Allgemeinbildung sowohl der Vergangenheit als auch der Gegenwart verfügen, unsere Analysen nicht unbedingt nachvollziehen können. Deswegen sind meine Refrains oft leichter zu verstehen und nehmen die beabsichtigte Aussage des Liedes noch einmal auf. Aber ich finde diese kleine Barriere zwischen uns auch sehr interessant, da sie uns dazu drängt, kreativer zu sein, um uns Leuten aller Gesellschaftsklassen anzunähern. Und das Publikum kann sich dadurch besser auf unsere Lieder einlassen.
Wie entstehen die Lieder? Erst der Text, dann die Musik – oder umgekehrt?
Ich bin ein Sänger, und wenn ich eine Idee habe, fange ich immer mit dem Refrain an. Erst wenn ich diesen gefunden habe, schreibe ich das Lied. Für mich ist wichtig, dass das Thema und die Emotion, die das Thema auslöst, nicht voneinander zu trennen sind. Das ist ein kreativer Prozess, (beginnt den Refrain eines Liedes leise zu singen). Wenn ein neues Lied entsteht, denke ich augenblicklich daran, wie die Gefühle der Menschen wohl sein werden, wenn sie es hören. In meiner Vorstellung bin ich stets eng mit dem Publikum verbunden.
„Hobskur – le petit soldat legendaire” – warum dieser Künstlername?
Das H und das K in Hobskur stehen im Bezug zu meinem eigenen Namen und Vornamen. Hobskur steht sinngemäß für obscurité (Finsternis), also etwas das als negativ und dunkel wahrgenommen wird. Geht man jedoch mehr in die Tiefe, so legt die Finsternis doch den Ausgangspunkt alles Guten oder Schlechten fest. Ich denke, mit der Zeit habe ich den Namen angenommen, um diese klassische Interpretation, die Finsternis als etwas Negatives zu sehen, zu dekonstruieren.
„Petit soldat légendaire” (Kleiner legendärer Soldat) wurde im Laufe der Jahre zu meinem zweiten A.K.A.. Der Grund hierfür war zum einen mein Engagement für die Projekte anderer Künstler und Künstlerinnen, denen ich hier und da behilflich war, und zum anderen mein Großvater, der ein kamerunischer Soldat war. Als er mir von der Kolonialzeit erzählte, sagte er mir zum allerersten Mal: „Du bist ein guter Soldat”.
Sie haben Konzerte in Paris, in London, in Berlin gegeben. Wie ist die Resonanz auf Ihre künstlerischen Projekte in Europa? Erreichen Sie auch die Eltern der jungen „Génération Change“?
Seitdem ich in Europa auftrete, ist es mir häufiger passiert, dass mich Erwachsene ansprechen. Sie wollen wissen, ob meine Lieder irgendwo erhältlich sind. Man merkt, dass sie meine Art, die Themen zu präsentieren, wertschätzen. (lacht) Ich erinnere mich an eine Freundin der Gruppe Buffalo Cotton, die zwei Tage nach dem Konzert „Génération Change“ am 20 Mai 2016 im Pleyel Turm in Paris zu mir kam. Ihr Vater, meinte sie, hätte gar nicht damit aufgehört, ihr zu sagen, dass ich eigentlich keinen Rap mache. Ich sei ein Erzähler.
Jedenfalls glaube ich, mit der wirklichen Arbeit auf europäischer Ebene noch gar nicht angefangen zu haben, aber das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Sie engagieren sich in Kamerun mit Freunden in sozialen Projekten, dort wo die Menschen wohnen, arbeiten, zu Schule gehen… und heben den Wert des Gemeinschaftlichen im Zusammenleben in den Quartiers hervor. Vor allem Jugendlichen wollen Sie vermitteln, dass sie eine Perspektive haben…
Ja, ich bin nicht nur ein Künstler auf der Bühne, sondern auch ein Mann, der auf dem Boden steht. Ich begleite meine Projekte daher sehr oft, indem ich ganz konkret Räume für die Begegnung schaffe. So biete ich Jugendlichen, die nicht die Möglichkeit haben, sich auf den zu Verfügung stehenden Plattformen zu entfalten, eine Ausdrucksform, die sie aufgreifen können. Und ich bin überzeugt davon, dass gerade die Chance, die wir den Jungen anbieten, die aus unterschiedlichen Vierteln und Milieus kommen… dass die künstlerische Herangehensweise zugleich den Mythos des sozialen Status aufbrechen kann und an dessen Stelle die Wertschätzung des Potenzials der einen für die anderen tritt.
Mit der „Génération Change“ wollen wir die Menschen dazu bringen, als Kollektiv zu arbeiten, sich als Kollektiv zu begreifen, damit in jedem Einzelnen oder in jedem Bewohner eines Stadtteils das Gefühl aufflammt, sich sein Wohnviertel wieder aneignen zu können. Denn alles, was man gemeinsam aufbaut, beschützt man auch gemeinsam. Aber es geht dabei nicht darum, die ohnehin schwache oder nicht bestehende Beziehung zwischen Bevölkerung und Staat zu unterbinden. Im Gegenteil! Es ist die avantgardistische Arbeit, die die Bevölkerung darauf vorbereitet, den sozialen Vertrag, den es zwischen Staat und Bevölkerung geben sollte, einzufordern.
In der neuen Kampagne „StopMurderingAfricanPeople“, die im Sommer 2016 in Douala ins Leben gerufen wurde, geht es auch um das Überwinden des Kolonialismus im Kopf und um eine neue Solidarität zwischen „Menschen in Uniform“ und „normaler“ Bevölkerung. Welche Strategie steckt dahinter?
Tatsächlich ist es ein Projekt der Dekonstruktion der Barrieren, die das Kolonialsystem errichtet hat, um die Politik in Afrika besser kontrollieren zu können. Das Projekt zielt also darauf ab, Menschen in Uniform mit der Bevölkerung zu solidarisieren, für die sie unter normalen Umständen verantwortlich wären. Seit der und selbst vor der Unabhängigkeit haben Menschen in Uniform in Kamerun, kontrolliert von Frankreich, einen repressiven Charakter. Wir sind also immer noch Zeugen der theatralischen Neuauflage des kolonialen Willens, der der sozio-politischen Entfaltung der Bevölkerung nicht gerade förderlich ist. Bei diesem Projekt, das nur ein Anfang ist, geht es darum, an die Uniformierten zu appellieren, ihren Teil der Verantwortung bei der Geiselnahme unseres nationalen Erbes durch eine Minderheit zu erkennen. Durch ihre Taten, die sehr oft mörderisch sind, „den Finger am Abzug“, sind sie Komplizen des Systems.
Ich glaube nicht, dass es einer Gesellschaft gut tut, wenn ein Kind mit dem Bild einer repressiven Armee und Polizei aufwächst. Im Gegenteil! Es sollte sich in deren Gegenwart sicher fühlen. Wenn wir es mit diesem Projekt schaffen, die Korps mit den Interessen der Bevölkerung zu solidarisieren, statt deren Henker zu sein, wird es um ein vieles einfacher sein, dass Meinungsfreiheit herrscht. Von da an wird aus der Mitte unserer Quartiers konstruktives politisches Engagement entstehen.
Ich denke, und dessen bin ich mir fast sicher, dass die Belastung, die die Geschichte durch den repressiven Charakter der Polizei und der Kolonialarmee auf die Bevölkerung ausgeübt hat, einer der Gründe für das fehlende politische Engagement der Jugendlichen und mancher ihrer Eltern ist. Manche haben in der Epoche des kamerunischen Unabhängigkeitskampfes (1950-1960) miterlebt, dass die französische Armee Massaker im Gebiet der Bassa und Bamiléké unter den Befreiungskämpfern anrichtete, und halten die Erinnerung daran wach. Viele glauben, dass Widerstand gegen das System nichts ändern wird. Nirgendwo auf der Welt möchte ein Elternteil sein Kind in Gefahr bringen, für etwas, das scheinbar keinen Erfolg zeigen wird.
Auch ohne ein „Spezialist“ für die Beweggründe des Sozialverhaltens der Kameruner und Kamerunerinnen zu sein, glaube ich, dass die Resozialisierung aller Gesellschaftsschichten bei dem Bestreben nach Solidarität von Polizei und Armee mit der Bevölkerung eine Tür zu einer weniger schmerzhaften Zukunft öffnet. Man muss außerdem immer wieder daran erinnern, dass viele der Uniformträger selbst aus den Vierteln stammen, in die sie im Auftrag des Systems geschickt werden, um „aufzuräumen“.
Sie waren im August und September 2016 in Douala, um in Ihrem Studio das Lied „Ne tire plus sur le peuple“, kurz: „Hör auf zu schießen!“ aufzunehmen, das auf allen sozialen Netzwerken bekannt gemacht werden soll. Ganz aktuell ist das gleichnamige Video auf YouTube zu sehen. Wie sind Ihre Eindrücke nach der Reise?
Wir waren sehr produktiv in den fünf Wochen, währenddessen ich in Douala war. Wir haben das Lied „Ne tire plus sur le peuple“ aufgenommen und das Video gedreht, die die Kampagne tragen. Leider wurde der erste große Showcase, der auf dem Marché Kongo in Douala stattfinden sollte, von den Behörden verboten. Sie begründeten ihre Entscheidung mit der „Unsicherheit des Ortes“, aber sie wollten offensichtlich nicht, dass unsere Botschaft Gehör finden sollte. Aber wir werden uns nicht aufhalten lassen und wir werden versuchen, mit dem Lied und dem Video mehr Leute zu mobilisieren.
Als einen ersten Schritt geplant, ein kleines Fußballsolidaritätsturnier in einem Stadtviertel zu organisieren, auch das konnten wir nicht umsetzen. Es war schwierig, Polizisten zu überzeugen, sich unserem Vorhaben anzuschließen, ohne dass ihre Vorgesetzten das bewilligt haben. Das beweist, dass Polizisten nicht unabhängig oder frei sind, sich zu solidarisieren und Teil einer sozialen Bewegung zu werden. Trotz dieser Schwierigkeiten haben wir es geschafft, junge Leute aus den Vierteln und aus der nahen Umgebung zu motivieren und einen Cross Country Lauf zwischen den Vierteln Oyack und Bilongue zu organisieren, um unsere Botschaft zu verbreiten: dass wir eine Polizei brauchen, die sich mit dem Kampf der zivilen Bewegungen solidarisiert. Es haben dreißig Leute teilgenommen, darunter auch vier Mädchen. Sie haben die T-Shirts unserer Kampagne „Nous voulons une police solidaire des combats“ getragen, und wir haben überall im Viertel Plakate aufgehängt.
Wir waren gerade zusammen in der Ausstellung „Deutscher Kolonialismus” im Deutschen Historischen Museum in Berlin und Sie haben bei der inoffiziellen Eröffnung mit anderen Musikern das Lied „C‘ est encore moi” vorgestellt. Das Lied erzählt davon, trotz aller Widrigkeiten und Gewalt stark zu sein, den Kampf nicht aufzugeben, „weil die Zukunft uns gehört”!
Das Afrikabild der Europäer ist immer noch stark vom Kolonialismus geprägt. Glauben Sie daran, dass der Paternalismus gegenüber Afrika in naher Zukunft überwunden werden kann?
Wenn man die Ursprünge politischer Konflikte vor und nach der Unabhängigkeit auf dem afrikanischen Kontinent genau beobachtet, stellt man mit Bedauern fest, dass diejenigen, die das Einhalten von Gesetzen predigen und vor aller Augen Tribunale inszenieren, die wahren Dirigenten jeglicher Dramen in Afrika sind. Ich bin auch der Meinung, dass die Politik, so wie sie im Westen gedacht wird, den Afrikanern nicht als ein Muster auferlegt werden soll. Um es deutlicher zu sagen: Es ist an der Zeit, dass Frankreich aufhört, der ganzen Welt vorzugaukeln, es sei das Mutterland der Menschenrechte und dass Frankreich sich bemühe, die Länder zu unterstützen, denen es willentlich ihre Unabhängigkeit gewährt hat, obwohl es weiterhin die Fäden zieht und von Paris aus Staatsstreiche und gefälschte Wahlen organisiert.
Seit jeher ist es Frankreich, das die Afrikaner teilt, indem es ethnische Konflikte nährt und Waffen liefert, um sich inmitten des Blutes und Schweißes besser der Länder zu bedienen, die Frankreichs Interessen dienen.
An diese Gedanken knüpft auch Ihr neues Projekt an, an dem Sie in Berlin mit anderen Musikern arbeiten. Sie sagen, es geht um die Fremden, die Afrika okkupieren?
Ja, gegenwärtig arbeite ich mit einem deutschen und englischen Musiker an einem neuen Stück. Es ist eine Kritik an der Politik des Westens gegenüber Kamerun und ganz Afrika im allgemeinen, man kann auch sagen, es ist eine Kritik am Neokolonialismus. Beispielsweise greifen wir das Thema der Präsenz der französischen Armee und der Militärcamps in Afrika als eine Form der Repression auf. Die Herrschaft über die Waffen verleiht diesen Menschen Kontrolle über die Politik. Wir wollen keine Militärstützpunkte mehr in Afrika. Afrika muss sich selbst aufbauen dürfen!
Mein neues Lied stellt die Frage: (beginnt leise zu singen): „Tu peux me dire pourquoi il y ‚a autant de morts et de bombes qui nous innondent? Pourquoi l‘ONU laisse le Pentagon jouer le sapeur en étouffant la colombe?” Wir müssen uns doch fragen: Warum wird Afrika von den Waffen aus Europa überschwemmt? Wer profitiert davon? Wer baut die Waffen und wer verkauft sie? Wie kann man von Frieden sprechen, während man im gleichen Atemzug Waffen herstellt? Waffen sind für den Krieg gemacht und können niemals dem Frieden dienen. Für die Deutschen und Franzosen ist die Herstellung von Waffen ein Geschäft. In Afrika werden bekanntlich keine Waffen hergestellt, trotzdem gibt es viele Kriege. Also liegt die Tatsache, dass es in Afrika trotzdem Waffen gibt, daran, dass sie in Europa hergestellt werden. Man verkauft uns Waffen, damit wir uns untereinander bekriegen. Es ist eine zutiefst destruktive Politik, obwohl man behauptet, dass man eine friedliche Welt wolle. Man kann nicht den Frieden wollen und zeitgleich mit Waffen Geschäfte machen. Wir sind nicht stetig auf dem Weg zum Frieden, wir gehen weiter Richtung Zerstörung und Dominanz. Derjenige, der die Waffe besitzt, herrscht.
Afrika will auf sich selbst bezogen sein! Wir wollen über uns selbst bestimmen. Unsere Kritik richtet sich auf die fortgesetzte Dominanz Europas und gegen den Kolonialismus im neuen Gewand: „Sagt Frankreich, wir wollen CFA nicht mehr.“ Wir haben die Nase vom CFA-Francs voll, denn das ist auch eine Form der Ausbeutung. Frankreich produziert unser Geld, warum? Warum entscheidet Frankreich über unsere Devisen? So kann es keine wirtschaftliche Unabhängigkeit geben. Auch politisch nicht, denn es sind wieder die gleichen Personen, die darüber entscheiden, wer an die Macht kommt und wer als Diktator geduldet wird; wer als kriminell verurteilt werden kann und wer nicht. Man wird in Afrika zum Kriminellen abgestempelt, wenn man nicht mit dem Westen einverstanden ist. Solange man mit dem Westen in Einklang ist, ist man ein guter Präsident. Vor ein paar Jahren habe ich in „les mêmes” die Frage gestellt: „Wir sind die Herumtreiber, aber wer sind die Diebe?”. Diese Frage zu stellen, bleibt aktuell.





 ©ijb
©ijb